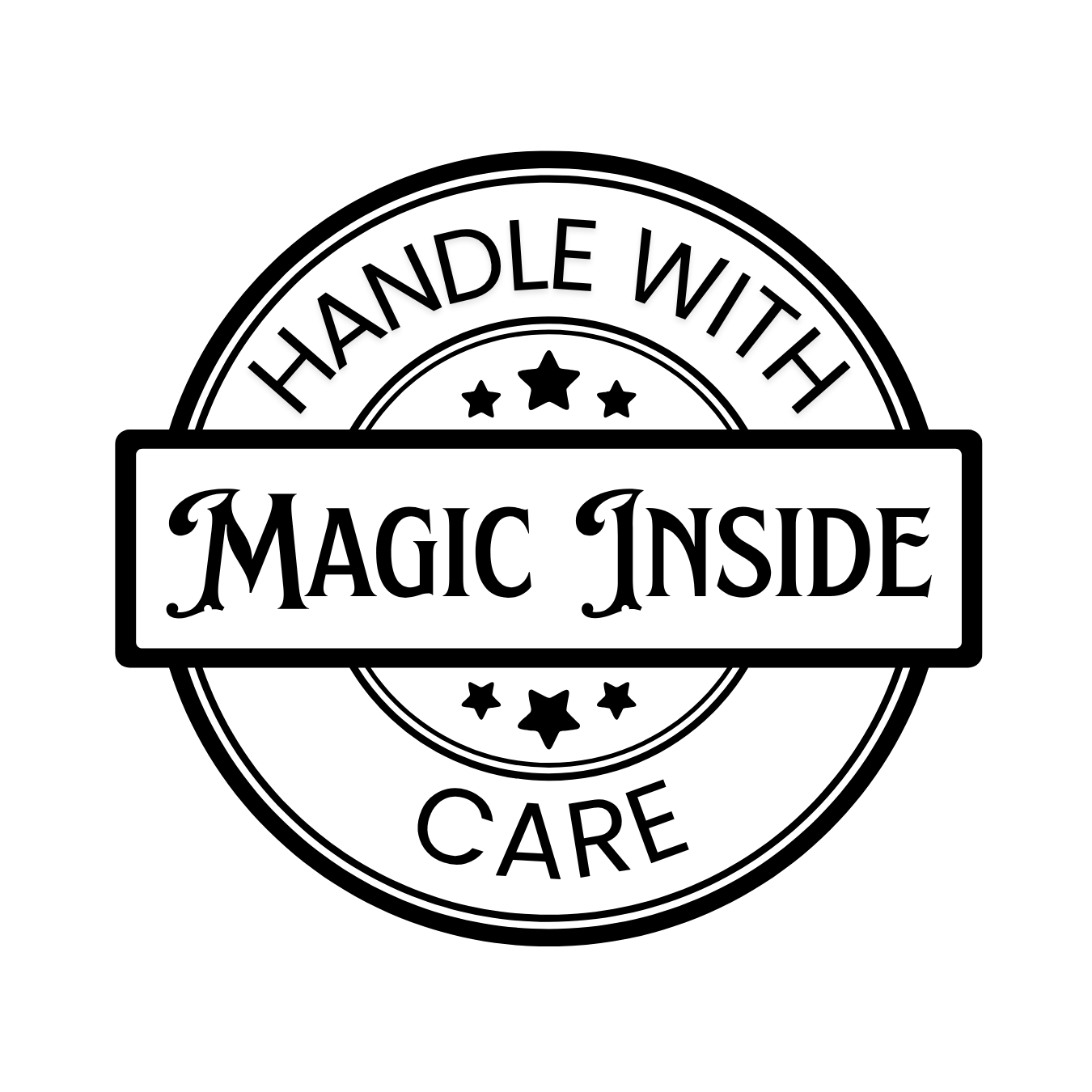Ein persönlicher Erfahrungsbericht
Ich war 33, als ich mir meinen ersten eigenen Hund geholt habe.
Und obwohl ich Tiere immer geliebt habe, war es keine dieser Entscheidungen, die man jahrelang plant. Es war eher ein Gefühl, das sich langsam eingeschlichen hat. Dieses leise Jetzt wäre es stimmig.
Heute, einige Zeit später, werde ich oft gefragt:
Würdest du es wieder tun?
Die ehrliche Antwort ist: Ja.
Aber ich würde vieles anders – oder zumindest informierter – angehen.
Die romantische Vorstellung
Wenn man mit Anfang 30 einen Hund bekommt, passiert das oft in einer Phase, in der man glaubt, sein Leben halbwegs im Griff zu haben. Man kennt sich selbst besser, weiß, wie man arbeitet, reist, seine Zeit einteilt. Ich dachte: Perfekt. Jetzt bin ich bereit.
In meinem Kopf sah das so aus:
Morgendliche Spaziergänge, ein Hund, der ruhig neben meinem Schreibtisch liegt, Wochenenden in der Natur, vielleicht sogar Reisen gemeinsam. Ein Gefährte, der mein Leben ergänzt, ohne es komplett auf den Kopf zu stellen.
Was ich unterschätzt habe: Ein Hund ergänzt dein Leben nicht – er verändert es. Fundamental.
Die Realität beginnt leise
Die ersten Tage waren magisch. Dieses kleine Wesen, das sich an dir orientiert, dir vertraut, dir folgt. Aber ziemlich schnell kamen auch die anderen Gefühle:
Überforderung. Verantwortung. Zweifel.
Plötzlich ist da niemand mehr, der spontan bis 22 Uhr im Café sitzen bleibt. Niemand, der mal eben übers Wochenende wegfährt, ohne vorher drei Pläne zu machen. Und niemand, der sich krank ins Bett legen kann, ohne trotzdem rauszugehen – bei Regen, Wind oder Fieber.
Ich merkte, dass ein Hund nicht nur Zeit kostet, sondern mentale Präsenz verlangt. Du kannst ihn nicht „mitlaufen lassen“. Er braucht Struktur, Aufmerksamkeit, Training, emotionale Sicherheit.
Die kleinen Abenteuer dazwischen
Was sich fast unbemerkt verändert hat: Spaziergänge sind keine reinen Wege von A nach B mehr. Sie werden zu kleinen Abenteuern. Man bleibt stehen, schaut genauer hin, entdeckt Ecken, an denen man vorher achtlos vorbeigegangen ist. Nicht, weil man plötzlich besonders achtsam sein will, sondern weil der Hund es ist.
Durch ihn bewege ich mich langsamer durch die Welt. Mit offeneren Augen. Der Alltag bekommt kleine Unterbrechungen – ein interessantes Geräusch, eine Spur im Gras, ein unerwarteter Richtungswechsel. Es ist keine große Magie, eher eine Rückkehr zu etwas Einfachem: draußen sein, beobachten, präsent sein. Und genau darin liegt ein stiller Wert, den ich vorher unterschätzt habe.
Arbeiten mit Hund – Wunsch vs. Wirklichkeit
Einer meiner größten Denkfehler war das Thema Arbeit.
Ich dachte: Ich arbeite flexibel, oft von zu Hause – das passt perfekt.
Tut es – theoretisch.
Praktisch bedeutet das:
Meetings mit Hintergrundgeräuschen. Unterbrechungen. Ein Hund, der nicht automatisch versteht, dass dein Laptop gerade wichtiger ist als sein Spielzeug. Und vor allem die Frage: Kann mein Hund wirklich alleine bleiben? Und wenn ja – wie lange, wie oft, unter welchen Umständen?
Auch das „Ich nehme ihn einfach mit ins Office“ ist in der Realität viel komplizierter, als es klingt. Nicht jeder Arbeitsplatz ist hundetauglich. Nicht jeder Hund ist entspannt genug dafür. Und nicht jeder Tag erlaubt diese Flexibilität.
Das unterschätzte Thema: Alleinsein und Betreuung
Was ich wirklich zu wenig bedacht habe, war mein Hundesitter-Netzwerk. Ich lebe in einer Partnerschaft, und damit stellt sich zwangsläufig auch die Frage: Will mein Partner einen Hund? Bei uns war das kein hundertprozentiges Ja – heute ist es definitiv große Liebe zwischen den beiden. Trotzdem war mir von Anfang an klar, auch aufgrund unserer Jobs, dass der Großteil der Betreuung bei mir liegen würde.
Was vieles erleichtert, ist, wenn ein Hund gut alleine bleiben kann. Und das ist weniger eine Charakterfrage als eine Frage von Training und Gewöhnung. Kein Hund bleibt wirklich gern allein – aber man kann es ihm beibringen, auch einem Pudel. Dennoch bleibt das Alleinsein ein sensibles Thema, das Zeit, Geduld und Konsequenz braucht.
Denn man kann seinen Hund nicht überallhin mitnehmen. Einkaufen, Gym, Kino, manche Reisen oder ein paar Stunden Spa – all das funktioniert nur, wenn entweder das Alleinsein gut klappt oder verlässliche Betreuung vorhanden ist. Spätestens dann wird dieses Thema sehr real.
Freunde sagen schnell: Ach, ich passe gern mal auf.
Aber zwischen mal und wirklich zuverlässig liegt ein großer Unterschied. Außerdem sind es ja meist genau die engen Freunde die den Hund nehmen würden mit denen man dann gerne auch etwas unternimmt.
Stelle dir ehrlich diese Fragen:
Was ist wenn du krank bist?
Was ist, wenn du spontan verreisen musst?
Wenn dein Hund besondere Bedürfnisse hat oder nicht überall problemlos funktioniert?
Ein Hund ist kein Koffer, den man einfach abstellt. Du brauchst Menschen, denen du nicht nur vertraust, sondern die auch tatsächlich verfügbar sind. Und dieses Netzwerk lässt sich nicht improvisieren – es muss wachsen, lange bevor man es dringend braucht.
Emotionale Verantwortung
Ein Hund braucht mehr als Futter und Spaziergänge. Er braucht Aufmerksamkeit, Beschäftigung und das Gefühl, eingebunden zu sein. Nicht permanent, aber regelmäßig und verlässlich. Man kann nicht erwarten, dass ein Hund ausgeglichen ist, wenn er geistig unterfordert ist oder zu oft „nebenbei“ läuft.
Gerade im Alltag, wenn man selbst viel zu tun hat, merkt man schnell, wie sehr ein Hund davon abhängt, dass man sich bewusst Zeit nimmt. Für Training, für kleine Aufgaben, für gemeinsames Tun. Es geht weniger um Dauer als um Qualität – aber auch die muss man sich nehmen.
Es gab Momente, in denen ich mich gefragt habe, ob ich dieser Verantwortung immer gerecht werde. Und genau diese Frage sollte man sich idealerweise vorher stellen – nicht erst dann, wenn der Hund schon da ist.
Die Frage der Rasse – und was ich heute anders sehe
Ein Punkt, den ich damals kaum hinterfragt habe, ist die Herkunft meines Hundes.
Ich habe mich für einen Zuchthund entschieden – nicht aus Statusgründen, sondern weil ich ironischerweise gegen Tierhaare allergisch bin (und ja ich war dennoch jede Woche reiten, hatte Katzen und bin jetzt Hundemum.) Die Wahl zum Pudel hat mir Sicherheit gegeben. Planbarkeit. Ein vermeintlich besseres Einschätzen von Charakter, Größe, Bedürfnissen.
Heute, mit allem, was ich gelernt habe, sehe ich das differenzierter. Nicht, weil ich meinen Hund jemals wieder hergeben oder „anders wollen“ würde – im Gegenteil.
Aber je mehr ich über Tierheime, Abgabehunde und Tierheimhunde gelernt habe, desto schwerer fällt es mir, den Kauf eines Hundes noch wirklich zu rechtfertigen.
So viele Tiere warten auf ein Zuhause, so viele bringen bereits so viel Geschichte, Charakter und Dankbarkeit mit. Würde ich mich heute noch einmal entscheiden, wäre der Weg ins Tierheim vermutlich der erste.
Alleinsein, Spontanität – und der stille Verlust davon
Was ebenfalls oft unterschätzt wird: Wie schwer Alleinsein für Hunde wirklich ist.
Man kann es trainieren, ja. Aber es bleibt ein sensibles Thema, das viel Geduld, Zeit und emotionale Präsenz braucht.
Spontanität, wie man sie vorher kannte, verschwindet fast unbemerkt aus dem Leben. Ein spontanes After-Work-Getränk, ein ungeplanter Wochenendausflug, einfach länger bleiben, weil es gerade schön ist – all das muss plötzlich abgewogen werden.
Ein Hund zwingt dich, vorauszudenken. Und auch wenn genau das manchmal entschleunigend und heilsam ist, fühlt es sich an manchen Tagen schlicht einschränkend an.
Diese Ehrlichkeit fehlt oft in den romantischen Erzählungen über das Leben mit Hund – gehört aber genauso dazu.
Würde ich es wieder tun?
Ja. Aber nicht mehr so naiv.
Ich habe mit Sicherheit versucht mir alle Minuspunkte schönzureden und würde mir vorher einige Fragen ehrlich beantworten:
-
Wie flexibel ist mein Alltag wirklich?
-
Wer hilft mir, wenn ich ausfalle?
-
Wie sehr bin ich bereit, mein Leben langfristig anzupassen – nicht nur in den ersten Monaten?
Ein Hund ist keine Phase. Er ist eine Entscheidung für viele Jahre.
Was bleibt
Trotz allem habe ich durch meinen Hund viel gelernt. Vor allem, präsenter zu sein und Verantwortung nicht als etwas Schweres zu begreifen, sondern als Beziehung.
Nähe spielt dabei eine größere Rolle, als ich erwartet hätte – Berührung, gemeinsames Kuscheln, dieses bekannte „Kuschelhormon“ Oxytocin, aber auch die unerwarteten Lachmomente, wenn der Hund wieder etwas völlig Eigenes macht. All das bereichert meinen Alltag spürbar.
Er zwingt mich, rauszugehen, auch an Tagen, an denen ich es selbst nicht tun würde. Und er erinnert mich daran, dass Dinge wie Nähe, Routine und Vertrauen keine abstrakten Konzepte sind, sondern etwas sehr Konkretes, das jeden Tag neu gelebt werden muss.
Würde ich es wieder tun?
Ja. Aber nur mit offenen Augen – und deutlich besser vorinformiert.